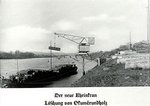von Friedel Wulf Kupfer
Zur Biographie des Gründers
Der Gründer dieses großen holzverarbeitenden Werkes, Gustav Hobraeck, wurde am 21. März in Mehren, einem kleinen Westerwalddorf im Kreis Altenkirchen, geboren.
Seiner Veranlagung entsprechend entschied sich Gustav Hobraeck schon früh für den kaufmännischen Beruf. So begann er seine Lehre in Berlin in der Möbelfabrik seines Onkels, wo er den Rohstoff "Holz" kennen lernte, dessen Erforschung und Verarbeitung sein späteres Leben erfüllen sollte. Hart sind offenbar die Lehrjahre für ihn gewesen, denn zu dieser Zeit stand es wirtschaftlich nicht gut um die Berliner Möbelindustrie. Nach Abschluß der Lehre siedelte der junge Kaufmann nach Höchst über, wo die Holzbranche damals eine größere Rolle zu spielen begann. Nachdem er einige Zeit für eine Möbelfabrik tätig war, gründete er im Alter von 24 Jahren die Firma Hipp & Hobraeck, aus der später die Möbelfabrik Heist & Hobraeck hervorging. Im Jahre 1909 schied er aus dieser Firma aus. Nach einem ereignisreichen Leben verschied Hobraeck am 22. März 1939 an den Folgen eines Schlaganfalls.
Die Firma Hobraeck
Gustav Hobraeck begann am 1. Juli 1911, ein altes verlassenes Eisenwerk (zuvor die "Germaniahütte") wieder aufzubauen. Vor allem die verkehrsgünstige Lage (direkt an einem Fluss) sprach für den Standort. Mit 12 Mann wurden anfänglich in 10-stündiger Schicht eine Furniersäge, ein Furniermesser und ein Gatter betrieben, wozu ein 60PS-Lokomobil die Antriebskraft lieferte.
Die Produktion war anfangs nicht gerade groß, so dass ein Einkäufer genügte, um in den nahen Waldungen an Mosel und Lahn die Stämme zu besichtigen. Gemessert wurden hauptsächlich deutsche Hölzer, wie Eiche, Buche, Pappel, Ulme und Kirschbaum. Die Furniere fanden Absatz bei Möbel_ und Sperrholzplattenfabriken in der näheren Umgebung.
Es war ein Zeichen günstiger wirtschaftlicher Entwicklung, dass bereits 1912 ein weiteres Furniermesser aufgestellt werden konnte. Die Belegschaft wurde um einige Leute erhöht.
Bemerkenswert ist hierbei die Tatsache, dass die Zahl der für die Bewegung der Rundhölzer notwendigen Arbeitskräfte fast ebenso hoch war wie die Arbeitskolonnen, die im Messersaal und in dem damals noch recht primitiven Trockenbau beschäftigt wurden. Welch grundlegende Änderung 20 Jahre später: In kürzester Zeit und mit Leichtigkeit brachten elektrische Laufkranen die oft 100 und mehr Zentner schweren Hölzer an ihren Verarbeitungsort.
Einen weiteren Fortschritt brachte das Jahr 1913. Die Rundhölzer, die bis dahin vom Neuwieder Güterbahnhof durch Fuhrwerk abgeholt werden mussten, wurden jetzt mit den Waggons auf dem neu hergerichteten Bahnanschlussgleis direkt ans Werk geschafft. Eine zweite Furniersäge und ein weiteres Gatter wurden aufgestellt. Unermüdliche Kundenwerbung, verbunden mit solider Arbeit, brachten es dahin, dass nicht nur die rheinische Industrie beliefert wurde, sondern dass von jetzt an die Absatzgebiete nach Osten und Süden ausgedehnt werden konnten. In Stuttgart und Berlin wurden Auslieferungslager eingerichtet, die die dortigen Verbraucher mit Furnieren aller Art versahen.
Eine Sensation für den Betrieb war es jedoch, als zu dieser Zeit ein ganzes Schiff durch einen aus Linz herbeigeholten schwimmenden Kran auf dem Werksgelände ausgeladen wurde.
Die Entwicklung war in vollem Gange, als der hereinbrechende 1. Weltkrieg die Industrie vor eine neue, schwierige Situation stellte. Die Aufträge der Privatwirtschaft waren wie abgeschnitten, die Facharbeiter wurden, bis auf einige wenige, eingezogen. Aber rasch war die Umstellung vollzogen. Der Staat brauchte Sperrholz für Flugzeuge. Die Männer waren an der Front, und so mussten Frauen an ihre Stelle treten. Die nicht leichte Arbeit wurde jetzt von ihnen bewältigt. Der Bedarf an hauptsächlich dünnen, 0,25 Millimeter starken, Messerfurnieren war damals so dringend, dass die Furniere nass, wie sie vom Messer kamen, an die Verbraucherstätten abgeliefert wurden. Der negative Ausgang des Krieges, verbunden mit der nun folgenden Besetzung der Rheinlande, machten alle Anstrengungen zur Wiederaufnahme des normalen Vorkriegsgeschäftes zunichte. Die Auslieferungslager in Süddeutschland und in Berlin waren bereits während des Krieges wieder eingegangen, und ihr Wiederaufbau war zum großen Teil wegen der erschwerten Handelsmöglichkeiten zwischen besetztem und unbesetztem Gebiet unmöglich geworden.Von dem inzwischen käuflich erworbenen Fabrikgrundstück mit Gebäuden wurde der nördliche Teil von der Firma Rasselstein an die Gockel-Werke (Waggonbau), die allerdings nicht lange bestanden, verkauft.
Im Jahre 1920 wurde ein Vollgatter aufgestellt sowie ein neuer Trockner errichtet. Ferner wurde die alte Lokomobile ausrangiert und durch eine neue 250 PS stationäre Dampfmaschine mit Kesselanlage ersetzt.
Gleichzeitig wurde eine zweite Schicht eingeführt, die nur während der Wintermonate ruhte, wenn durch die in dieser Zeit einsetzende starke Nebelbildung die Trocknung der Furniere nicht mehr in ausreichendem Maße möglich war. Hinzu kamen Erschwerungen durch die Besatzung: Das geräumige Furnierlager am Rhein musste frei geräumt werden, weil die amerikanische Besatzung diese Halle als Futterlager für ihre Pferde und Esel nutzen wollte. Auch Naturereignisse erschwerten die Entwicklung: z.B. die verheerenden Hochwasser der Jahre 1920 und 1921 - damals wurden sogar eine ganze Anzahl Stämme vom Werk weg rheinabwärts oder in die Stadt getrieben.
Hatte man bis 1923 mit der Besatzung in leidlich guten Verhältnissen gelebt, so brachte die Ruhrbesetzung durch Franzosen und Belgier erneute Schwierigkeiten für das Werk: Die Zufuhr von Rundholz begann nun vollends zu stocken. Vor allem deswegen, weil in Folge des deutschen Protestverhaltens (Passiver Widerstand) die französischen Besatzungsbehörden das gesamte Eisenbahnwesen in ihre Regie übernommen hatten (Regiebahn). Sollte der Betrieb nicht ganz zum Erliegen kommen, musste ein Ausweg gefunden werden.
Motor-Kraftfahrzeuge (Lkw) gab es in der damaligen Zeit noch wenig und auf diese war bezüglich der Betriebssicherheit kein Verlass. So wurden dann Pferdefuhrwerke angeschafft, die auch aus den weiter gelegenen Distrikten die Hölzer auf das Werk brachten. Während die Beförderung auf dem Landweg erheblich beeinträchtigt war, wurde zwangsläufig der Gedanke, das Rohmaterial auf dem Wasser zu beziehen ,gefördert. Dazu bot der Rhein die beste Voraussetzung. Man hatte ja schon Erfahrungen mit dem bisher genutzten Schwimmkran gemacht. Warum sollte nicht ein stationärer Kran, mit dem die Rundhölzer direkt vom Schiff an das Lager geschafft werden konnten, noch wertvollere Dienste leisten?
Die Gelegenheit zur Errichtung einer solchen Anlage war gegeben, standen doch damals elektrische Kranen, die ursprünglich für militärisch Zwecke Verwendung finden sollten, zur Verfügung. Es kam deshalb zur Aufstellung eines stationären Rheinkrans mit 7 Tonnen Tragfähigkeit. Dieser Kran war einmal für die Helgoländer Befestigungsanlagen vorgesehen gewesen. Sein Ankauf von den deutschen Militärbehörden war leichter als seine Herbeischaffung. Die Anlieferung per Bahn war illusorisch. So blieb letztlich nichts anderes übrig, als das Gerät, das ein Gewicht von über 40 Tonnen hatte, mit Pferdefuhrwerken von Düsseldorf nach Neuwied zu transportieren. Die Anfuhr fand unter großen Schwierigkeiten, meist in Nachtfahrten, statt.
Nun konnten auch in großem Umfang überseeische Hölzer importiert werden. In Rotterdam wurden sie direkt vom Seeschiff in die Rheinkähne umgeladen.
Im Jahre 1934 wurde das Betriebsareal durch Hinzukauf eines Teils der ehemaligen Gockel-Werke erweitert. Damit erhielt die Front des Werks zum Rhein hin ihre endgültige Ausdehnung (Foto: Mauserwerke rechts und Firma Dyckerhoff links)
Im 2 Weltkrieg blieb die Fabrik vor größeren Schäden verschont, erlitt aber dennoch große Verluste, wie die gesamten Rundhölzer aus den zeitweise von deutschen Truppen besetzten Gebieten und Ostdeutschland wegfielen. Nachdem das Werk in der ersten Nachkriegszeit Notstandsproduktionen durchführte, begannen die Franzosen im Mai 1946 mit der Demontage der besten Maschinen. Bis zur Währungsreform 1948 schleppte sich die Produktion so recht und schlecht dahin. Ende 1949 endete das Besatzungsregime, unter dem die Firma seit 1945 gestanden hatte. Nun konnten endlich die Demontageverluste ausgeglichen werden. Nach diesen Jahren er Konsolidierung setzte 1953 der allmähliche Wiederaufstieg ein. Vor dem endgültigen Durchbruch zur modernen Zeit standen noch zwei erwähnenswerte Unglücke: 1955 explodierte die Kraftzentrale und wenig später kippte der große Rheinkran beim Ausladen von Stämmen in den Strom. Ende der 1950er Jahre begann die Modernisierung und Rationalisierung des gesamten Produktionsapparates. Die Kapazität wurde ständig erweitert. In den 60er und 70er Jahren wurden die Rundhölzer dann vom Schiff aufs Land durch eine moderne Kranbahn, die an die Stelle des alten Rheinkrans trat, zu den Holzlagerplätzen transportiert.
Die kontinuierliche Weiterentwicklung des Werkes erfuhr eine jähe Unterbrechung, als in der Nacht vom 7. Zum 8. November 1976 im Hauptlager ein Brand ausbrach, der sich zum schwersten Brand entwickelte, den Stadt und Landkreis Neuwied seit vielen Jahrzehnten erlebt hatten. Rund 300 Feuerwehrleute und Soldaten sowie Sanitäter aus Neuwied und Umgebung waren mit 36 Einsatzfahrzeugen im Nachteinsatz. Bis zu 80 Meter hoch war die Feuersäule. Die 13.000 Quadratmeter große Hauptlagerhalle mit wertvollen Furnierbeständen wurde ein Raub der Flammen. Noch nach Tagen mussten Brandwachen das Schwelfeuer unter Kontrolle halten. Es entstand ein Sachschaden von rund 10 Millionen Mark.
Von diesem Schlag erholte sich das Holzwerk nie mehr richtig. Die Produktion schleppte sich noch fünf Jahre dahin - dann kam im Februar 1982 der endgültige Zusammenbruch: 133 von 142 Mitarbeitern musste gekündigt werden, da die Produktion, wie es hieß "aufgegeben wurde". Absatzschwierigkeiten im Inland durch Billigimporte und die allgemeine Rezession der Möbelindustrie zwangen die Firmenleitung zu diesem Schritt. Lediglich ein kleiner, neu gegründeter Furnierholzhandel wurde weiter betrieben.
Der große Rheinkran hob in Neuwied mühelos die schweren Stämme aus ihrem Inneren und legte sie ans Ufer. Eine elektrische Kranenbahn sorgte zudem für die Heranschaffung der Rundhölzer an die Dämpfanlagen und von da aus an die Furniermesser.
Der Absatz stieg von Jahr zu Jahr - die erste Blütezeit des Unternehmens hatte begonnen. Die Zahl der Arbeiter stieg in den Jahren 1923 bis 1928 von 68 auf 115. Längst hatten sich die anfangs übernommenen und später umgebauten Gebäude als zu eng erwiesen. Die Kapazität musste vergrößert, Hallen und Lager ausgebaut sowie erweitert, nach dem 1. Weltkrieg angeschaffte Kraftstationen ausgetauscht werden. So wurde 1927 ein dritte Furniermesser aufgestellt, 1929 die 1920 angeschaffte 250PS-Dampfmaschine durch eine 600 PS-Einzylindermaschine ersetzt.
Nach der Übernahme der politischen Macht durch die Nationalsozialisten wurde im Werk ein neuer Betriebszweig eröffnet: Fabrikation von Gewehrschaftrohlingen. Werkstätte hierfür wurde das Gebäude, in dem ehemals das Vollgatter gelaufen war.